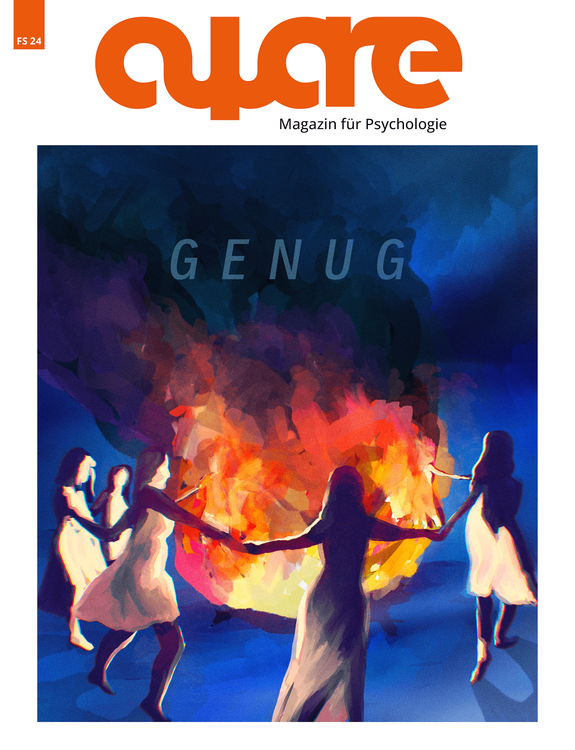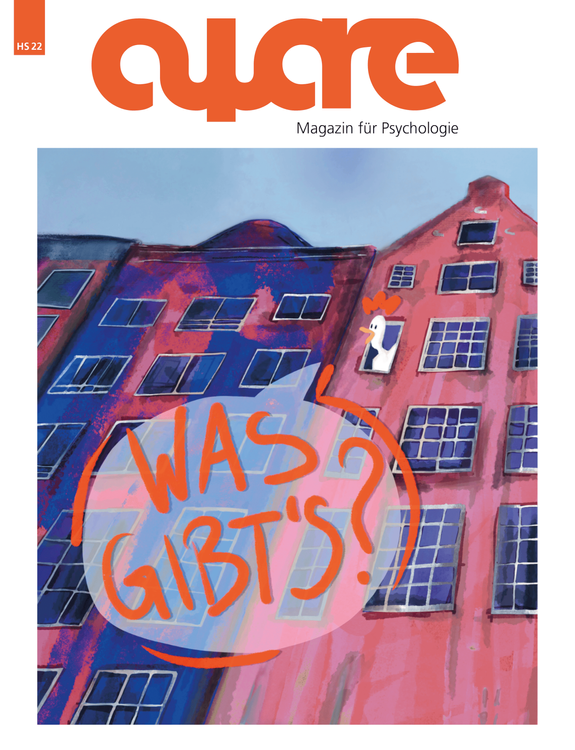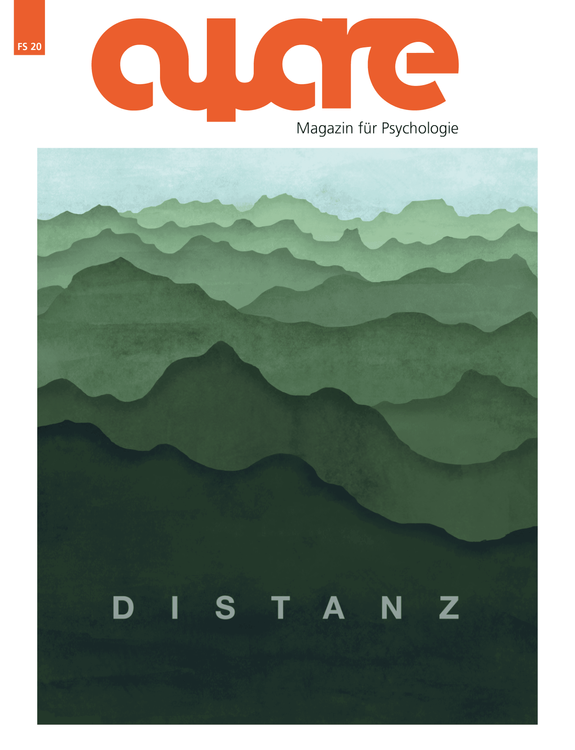Dass sich die Dynamik rund um «das liebe Geld» verändert, wird spätestens klar, wenn man die aktuellen Geschehnisse rund um den Bitcoin ETF verfolgt (lohnt sich nachzulesen!). Auch wenn sich die Definitionen von Geld und Besitz in Teilen wandeln, können Menschen viel oder wenig davon haben. Was für einen Einfluss hat der Besitz von Geld auf unsere Psyche?
G eld ist ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel und eine Recheneinheit für den Wert von Waren, Dienstleistungen und Vermögenswerten. Es erfüllt drei grundlegende Funktionen: 1. Geld erleichtert den Austausch von Gütern und Dienstleistungen, indem es als allgemein akzeptiertes Mittel fungiert, das im Handel verwendet wird. Anstatt Waren direkt zu tauschen, können Menschen Geld verwenden, um Güter von anderen zu kaufen. 2. Geld dient als Massstab, um den Wert verschiedener Güter und Dienstleistungen zu vergleichen. Durch die Festlegung von Preisen in einer Währung können Menschen leichter einschätzen, wie viel etwas wert ist und es mit anderen Gütern vergleichen. 3. Geld behält seinen Wert über einen längeren Zeitraum, wodurch es als Mittel zum Speichern von Vermögen dient. Menschen können Geld sparen und es zu einem späteren Zeitpunkt verwenden, um Bedürfnisse oder Wünsche zu erfüllen.
Geld kann in physischer Form existieren, wie Münzen oder Banknoten, oder digital in Form von elektronischem Geld auf Bankkonten. Es wird von Regierungen oder Zentralbanken ausgegeben und reguliert, um Stabilität und Vertrauen in das Finanzsystem zu gewährleisten (Cecchetti & Schoenholtz, 2014).
Studien haben gezeigt, dass Menschen beim Umgang mit Geld tatsächlich physische Schmerzempfindungen erfahren können. Die Vorstellung, Geld auszugeben oder finanzielle Verluste zu erleiden, aktiviert ähnliche Gehirnregionen wie körperlicher Schmerz. Dies unterstreicht, wie eng Geldbesitz mit unserer Psyche und neuronalen Korrelaten verbunden ist (Xu et al., 2009).
Die Bedeutung von Geld
Als bedeutender Bestandteil unseres Lebens beeinflusst Geld in vielfältiger Weise unsere Psyche. Der Besitz von viel oder wenig Geld kann tiefgreifende Auswirkungen auf verschiedene psychologische Aspekte haben.
Die Beziehung zwischen Wohlstand und psychischer Gesundheit ist vielschichtig. Untersuchungen zeigen, dass ein höheres Einkommen mit einem verbesserten psychischen Wohlbefinden korrelieren kann (Diener & Oishi, 2002). Finanzieller Spielraum ermöglicht es, grundlegende Bedürfnisse zu erfüllen und trägt zur Steigerung der Lebenszufriedenheit bei. Ein höherer sozioökonomischer Status kann zudem den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung erleichtern, was wiederum positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben kann (Adler & Rehkopf, 2008).
Zahlreiche Studien haben versucht, die komplexen Verbindungen zwischen materiellen Gütern und psychischem Wohlbefinden zu entschlüsseln. Forscher*innen wie Howell und Howell (2008) haben herausgefunden, dass der Besitz von materiellen Gütern kurzfristig empfundenes Glück steigern kann. Diese anfängliche Zufriedenheit kann jedoch mit der Zeit abnehmen, da sich Menschen an ihre Besitztümer gewöhnen. Dieses Phänomen, bekannt als «Hedonistische Tretmühle», legt nahe, dass die Suche nach immer mehr materiellen Gütern nicht zwangsläufig zu dauerhaftem Glück führt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle sozialer Vergleiche bei der Bewertung von Besitz. Belk (1985) betont, dass der Besitz bestimmter Güter oft mit einem höheren sozialen Status verbunden ist. Dies kann das Selbstwertgefühl und das psychische Wohlbefinden positiv beeinflussen. In jüngster Zeit hat die Bewegung des Minimalismus an Aufmerksamkeit gewonnen, wobei Forscher*innen wie Carver, Scheier und Fulford (2003) die Vorteile eines reduzierten Lebensstils hervorheben. Der bewusste Verzicht auf übermässigen materiellen Besitz kann nicht nur zu einer Verringerung von Stress führen, sondern auch das psychische Wohlbefinden insgesamt steigern.
Die Auswirkungen von nicht vorhandenem Geld
Armut hingegen geht oft mit erheblichem Stress einher und erhöht das Risiko für psychische Erkrankungen (Kawakami et al., 2001). Unsicherheit über finanzielle Ressourcen kann zu anhaltender Angst, Depression und anderen psychologischen Belastungen führen. Menschen in finanziell prekären Verhältnissen sehen sich nicht nur mit materiellen Einschränkungen konfrontiert, sondern auch mit sozialen Herausforderungen, die ihre psychische Gesundheit beeinflussen können (Kraus & Tan, 2015).

Menschen mit begrenzten finanziellen Ressourcen erfahren oft eine Vielzahl von psychologischen Belastungen, die sich negativ auf ihr Wohlbefinden auswirken können. Zahlreiche Studien haben sich mit den Gründen dafür auseinandergesetzt, warum finanzielle Knappheit zu psychischem Stress und schlechtem psychischen Wohlbefinden führen kann. Eine entscheidende Erklärung bietet die Theorie der sozialen Determinanten der Gesundheit, die erklärt, wie ökonomische Ungleichheit direkte Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden hat. Forschung von Adler et al. (1994) zeigt auf, dass ein niedriger sozioökonomischer Status mit einem erhöhten Risiko für psychische Gesundheitsprobleme wie Depressionen und Angststörungen verbunden ist. Finanzielle Unsicherheit und die damit einhergehende Sorge um grundlegende Bedürfnisse wie Unterkunft und Ernährung können zu chronischem Stress führen. Eine Studie von Pearlin und Schooler (1978) zeigt auf, dass anhaltender finanzieller Druck zu erhöhtem Stressniveau und einem gesteigerten Risiko für psychische Belastungen führen kann. Zudem wirkt sich finanzielle Knappheit auf den Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und anderen Ressourcen aus.
Auf staatlicher Ebene werden Massnahmen ergriffen, um die psychischen Auswirkungen von Geld zu mildern. Sozialpolitische Initiativen, wie finanzielle Unterstützung für einkommensschwache Familien oder Bildungsprogramme, werden implementiert, um soziale Ungleichheit zu verringern und psychologische Belastungen zu minimieren (Pickett & Wilkinson, 2015). Regierungen erkennen die Wechselwirkungen zwischen ökonomischem Status und psychischer Gesundheit immer besser und versuchen, durch gezielte Interventionen eine ausgewogenere Verteilung von Ressourcen zu fördern.
Zusammenfassend zeigen die genannten Studien und wirtschaftspolitischen Erkenntnisse, dass der Zusammenhang zwischen begrenzten finanziellen Mitteln und schlechtem psychischem Wohlbefinden auf eine komplexe Weise durch soziale Determinanten, chronischen Stress und den eingeschränkten Zugang zu Ressourcen geprägt ist.
«A temptation, when one has money, is to underestimate its importance and its ability to fulfill needs. But for those who don't have it, it is often the dominant factor in consciousness»
Kahneman, Tversky & das Risiko
Daniel Kahneman, ein Pionier in der Verhaltensökonomik und in der Psychologie, hat wegweisende Forschung durchgeführt, die unser Verständnis der menschlichen Entscheidungsfindung in Bezug auf Geld und Risiko vertieft. In seinem Buch Thinking, Fast and Slow (2011) argumentiert Kahneman, dass das menschliche Denken in zwei Systeme unterteilt ist: ein schnelles und ein langsames System. Das schnelle System basiert auf Intuition und spontanen Urteilen, während das langsame System auf bewusster, kontrollierter Analyse beruht. Bei finanziellen Entscheidungen wechseln Menschen oft zwischen diesen beiden Systemen hin und her. Eine Schlüsselerkenntnis von Kahnemans Forschung ist, dass emotionale Faktoren stark in finanzielle Entscheidungen verwickelt sind. Menschen neigen dazu, Risiken unterschiedlich zu bewerten, abhängig von emotionalen Zuständen und der Präsentation von Informationen. Zum Beispiel können Verluste intensiver wahrgenommen werden als Gewinne, was zu risikoscheuem Verhalten führt – ein Konzept, das als Verlustaversion bekannt ist (Tversky & Kahneman, 1991). Kahneman untersuchte auch den Einfluss von «Heuristiken», Faustregeln oder mentale Abkürzungen, die Menschen verwenden, um komplexe Entscheidungen zu vereinfachen. Diese Heuristiken können zu systematischen Denkfehlern führen, insbesondere wenn es um Geld und Risiko geht. Die Forschung von Kahneman hat weitreichende Implikationen für Wirtschaft, Finanzen und das Verständnis menschlichen Verhaltens. So haben seine Erkenntnisse nicht nur dazu beigetragen, Modelle wirtschaftlichen Entscheidungsverhaltens zu überdenken, sondern (sie) fanden auch wichtige Anwendungen in der Verhaltensökonomie.